
Ohne Kirche reißt das Netz: Wie katholische Werke das Gemeinwohl stützen
Am frühen Morgen füllt sich der Flur der Kindertagesstätte mit Stimmen. Kinder stürmen lachend in die Gruppenräume, andere klammern sich noch an die Beine ihrer Mama. In Deutschland werden rund 3,9 Millionen Kinder in Kitas betreut. Ein erheblicher Teil davon besucht eine Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft: Allein die katholische Kirche verantwortet fast 10.000 Kitas – das ist jede sechste Einrichtung.
Doch die Präsenz endet nicht bei den Jüngsten. Wer später ins Krankenhaus geht, im Alter Pflege braucht oder in einer Krise Unterstützung sucht, stößt auch dann auf katholische Einrichtungen.
Caritas in Zahlen
Bundesweit arbeiten hier rund 740.000 Hauptamtliche in über 25.000 Einrichtungen und Diensten. Damit gehört die Caritas zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Das entspricht etwa der Zahl der Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie.
Die Mitarbeitenden verteilen sich auf die folgenden Bereiche:
- Gesundheitshilfe: knapp 294.000 Mitarbeitende.
- Kinder- und Jugendhilfe: rund 184.000 Mitarbeitende.
- Altenhilfe: 127.000 Mitarbeitende.
- Behindertenhilfe: 90.000 Mitarbeitende.
Der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland
Das wichtigste Werk der katholischen Kirche ist die Caritas. Bundesweit arbeiten hier rund 740.000 Hauptamtliche in über 25.000 Einrichtungen und Diensten.
Doch die Caritas ist nicht das einzige große Wohlfahrtswerk: Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (KKVD) bündelt 261 Krankenhäuser an 330 Standorten mit rund 204.000 Beschäftigten. Jährlich werden dort etwa 3 Millionen Patientinnen und Patienten stationär sowie 2,5 Millionen ambulant behandelt. In der Altenpflege vertritt der Verband Katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD) rund 500 Träger, die mehr als 2.200 Einrichtungen und Dienste mit etwa 100.000 Mitarbeitenden betreiben.
Auch die Malteser gehören zu den bekannten katholischen Werken. Bundesweit engagieren sich dort rund 31.000 Hauptamtliche sowie über 50.000 Ehrenamtliche. Sie betreiben Rettungsdienste, Krankenhäuser, Pflegeheime und leisten Katastrophenhilfe. Dazu kommen zahllose kleinere Einrichtungen von Vereinen und Ordensgemeinschaften. Damit sind alle kirchlichen Einrichtungen gemeinsam der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland nach der Summe aller staatlichen Institutionen.

Woher kommt das Geld?
Wenn man sagt, ohne die Kirchen verlöre Deutschland eine wichtige Stütze gerade im sozialen Bereich, dann geben diese Zahlen einen Hinweis, was ohne kirchliche Institutionen fehlen würde. Allerdings kann man darauf einwenden: Die meisten dieser Institutionen erfüllen eine öffentliche Aufgabe und werden daher durch öffentliche Mittel finanziert: Die Kindergärten durch Kommunen und Elternbeiträge, die Krankenhäuser von den Krankenkassen, die Pflegedienste von der Pflegekasse. Daher kann man auch sagen: Die Kirche profitiere von einem sozialen System, an das sie ihre Institutionen angehängt hat. Der Platz der Kirchen kann also auch durch andere Träger ersetzt werden.
Das verkennt die Schwierigkeiten für viele Einrichtungen. Es stimmt: Die Institution Kirche leistet lediglich zu einem kleinen Teil Zuschüsse, etwa für den Unterhalt der Gebäude, für Investitionen oder für zusätzliche Angebote, oder sie organisiert ehrenamtliche Dienste, die von den öffentlichen Kassen nicht getragen werden; dazu kommen indirekte Zuschüsse: Viele Einrichtungen stehen auf kirchlichen Grundstücken, die weit unter dem Marktpreis verkauft oder verpachtet werden.
Doch selbst wenn diese Beiträge das Kerngeschäft nicht tragen. Sie machen etwas aus. Soziale Einrichtungen werden häufig mit engster Finanzierung geplant und betrieben. In vielen Kommunen kann eine Anschubfinanzierung von ein paar Hunderttausend Euro für den Bau eines Kindergartens entscheidend sein, das Projekt in Angriff zu nehmen. Und manches Sozialzentrum ist überhaupt nur deswegen lebensfähig, weil es nur eine symbolische Pacht für das Grundstück zahlen muss – schon ein paar Zehntausend Euro mehr im Jahr und die Schließung wäre sicher.
Das zeigt: Würde sich die Kirche spontan zurückziehen, könnten die nicht vollständig durch andere Institutionen übernommen werden.
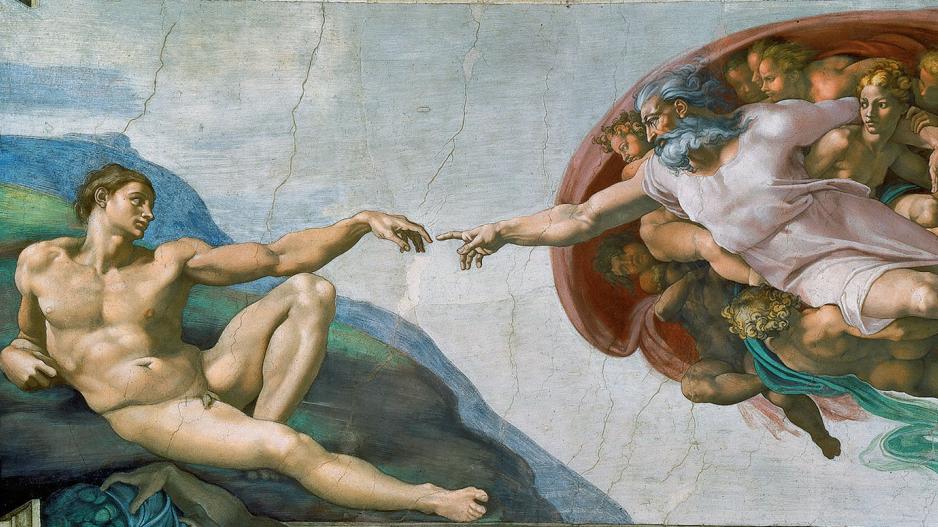
Das christliche Menschenbild – noch immer wertvolle Werte
Neben den finanziellen Ressourcen bietet die Kirche eine Werteordnung an. Grundlage ist das christliche Menschenbild: Jeder Mensch besitzt eine unveräußerliche Würde – unabhängig von Herkunft, Alter, Religion oder Leistungsfähigkeit. Wer in einer katholischen Einrichtung arbeitet, ist diesem Leitbild verpflichtet.
Der Dienst am Menschen ist in dieser Perspektive auch Teil der Gottesbeziehung. Deshalb geht es – bei allen Einschränkungen der praktischen Erfordernisse - nicht nur um funktionierende Abläufe oder wirtschaftliche Effizienz, sondern auch um Zuwendung, Anteilnahme und die bewusste Nähe zu Menschen, gerade in Grenzsituationen des Lebens. Im besten Fall verbindet sich Professionalität mit Spiritualität – Hilfe wird nicht nur geleistet, sondern zugleich als Ausdruck von gelebtem Glauben verstanden.
Die christliche Werteordnung und Weltdeutung stellt eine Perspektive zur Verfügung, die über die Logik des finanzielle getriebenen Systems hinausreichen. Denn auch im Wohlfahrtsbereich müssen sich Institutionen rechnen, wenigstens keinen Verlust erwirtschaften. In Zeiten knapper Kassen setzt das alle Beteiligten unter Druck. Eine christliche Ordnung zeigt sich besonders dort, wo das finanziell geprägte System Lücken aufweist: Etwa, wenn eine Patientin im Krankenhaus im Sterben liegt. Dann kann man sich auf die konzentrieren, die weiterleben werden – oder man informiert die Angehörigen schneller, gibt ihnen Hinweise, wie sie mit dem sterbenden Menschen umgehen können. Oder bei Kitas: Für Erzieherinnen sind homogene Kindergruppe einfacher. Aus einer christlichen Perspektive gilt es gerade in solche Gruppen auch andere Kinder aufzunehmen, um Teilhabe möglichst breit aufzustellen.

Eine starke Organisation
Es stimmt: Die Bedeutung der christlichen Kirchen nimmt ab. Und längst gibt es auch andere humanistische Weltbilder, die nicht (mehr) mit der christlichen Ordnung verbunden sind, die ergänzende Perspektiven einbringen. Doch solche Perspektiven müssen sich auch stets in Organisation übersetzen. Die Kirchen besitzen diesen hohen Organisationsgrad noch. Bei aller Säkularisierung gilt daher: Noch lange werden hunderttausende Kinder morgens in kirchliche Kitas hineinstürmen – und das ist auch gut so.


